- Menu
-
- Verwaltung, Politik und Bauen
- Landrat
- Verwaltung
- Kreistag und Wahlen
- Bekanntmachungen / Stellenangebote / Ausbildung
- Aktuelle Meldungen
- Digitale Bürgerdienste
- ÖPNV und Ostertalbahn
- Zulassungsstelle
- Ordnung
- Leitbild
- Bauen
1992–2007: Franz Josef Schumann
Da das Erreichen der Altersgrenze des amtierenden Landrats Waldemar Marner absehbar ist, verständigt sich der Kreistag des Landkreises St. Wendel während seiner Sitzung vom 9. September 1991, die Stelle des Landrats in der Saarbrücker Zeitung sowie in kommunalpolitischen Fachzeitschriften auszuschreiben. Am 1. März 1992 soll der Landrat vom Kreistag gewählt werden. Der Text ähnelt jenem aus dem Jahr 1986, mit dem damals, als der Kreistag zum ersten Mal den Landrat wählt, nach einem geeigneten Kandidaten gesucht wurde. Weiterhin wird eine „dynamische, verantwortungsvolle und entscheidungsfreudige Persönlichkeit, die sich mit Initiative und Tatkraft der gestellten Aufgaben annimmt“ gesucht. Neu ist die ausführliche Beschreibung des St. Wendeler Landes: „Der Landkreis St. Wendel ist im nördlichen Saarland gelegen und gehört zum Naturpark Saar-Hunsrück. Das St. Wendeler Land bietet einen hohen Ferien-, Urlaubsund Freizeitwert. Der Landkreis St. Wendel hat einen gesunden Gewerbe- und Industriebesatz und bietet auch weiterhin interessante Ansiedlungsmöglichkeiten. In der Kreisstadt St. Wendel sind alle einschlägigen Schulformen vorhanden.“ Bewerbungsfrist: 20. Oktober 1991.
Bis zum Fristende liegen der Verwaltung, anders als 1986, nicht eine, sondern fünf Bewerbungen vor. Vier Bewerber gehören der CDU an, einer der SPD. Die Stimmenverhältnisse im Kreistag: 14 CDU, 13 SPD. Daher halten es die Christdemokraten für ratsam, sich auf einen Bewerber zu verständigen. Verschiedene Parteigremien kommen zusammen, die der Kreistagsfraktion einen Kandidaten empfehlen, für die sich diese dann auch entscheidet: Franz Josef Schumann. Die drei übrigen CDU-Bewerber ziehen ihre Bewerbungen zurück.
So kommt der Kreistag des Landkreises St. Wendel am 11. November 1991 zusammen, um einen neuen Landrat zu wählen. Ort ist der Saalbau in St. Wendel, in den auch rund 300 Gäste kommen, um bei der Wahl des neuen Landrats dabei zu sein. Gegen den CDU-Kandidaten Schumann tritt für die SPD Horst Backes, Jahrgang 1952, an, der seine berufliche Laufbahn als Referent für Aus- und Fortbildung bei der Stadt Saarbrücken beginnt und 1985 ins Wirtschaftsministerium wechselt. Die Mitglieder des Kreistags, darunter drei Frauen, sind vollständig vertreten, der Vorsitzende, Landrat Marner, ruft zur geheimen Wahl auf, auf eine Vorstellung der beiden Kandidaten wird verzichtet. Das Ergebnis: 14 Stimmen für Franz Josef Schumann, 13 Stimmen für Horst Backes. Somit ist Schumann der 15. Landrat des Landkreises St. Wendel und der zweite, der vom Kreistag gewählt wird.
1948 in St. Wendel geboren, studiert Franz Josef Schumann nach dem Abitur Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes. 1975 wird er Dezernent der Kreispolizei- und Verkehrsbehörde des Staatlichen Bereiches der St. Wendeler Landratsverwaltung, 1982 zur Vertretung des Saarlandes nach Bonn abgeordnet. 1987 kehrt er nach St. Wendel zurück und ist in der Kommunalen Abteilung des Landratsamtes Ständiger Vertreter des Landrats im Staatlichen Bereich. Nach seiner Wahl 1991 zum Landrat des Landkreises St. Wendel durch den Kreistag wird Schumann 2001 durch die zwischenzeitlich eingeführte Urwahl für zehn Jahre wiedergewählt. Zwei Jahre vor Ablauf seiner zweiten Amtszeit legt er das Amt des Landrats des Landkreises St. Wendel nieder und wird Präsident des Saarländischen Sparkassenverbandes. Altersbedingt scheidet er 2013 aus diesem Amt aus.

Am 21. Februar 1992 versammeln sich rund 700 Gäste im St. Wendeler Saalbau. Der Grund: die offizielle Verabschiedung von Landrat Waldemar Marner und Einführung seines Nachfolgers Franz Josef Schumann. Der neue Landrat dankt für das Vertrauen, betont, er wolle sich für den Landkreis einsetzen, für jeden Bürger ansprechbar sein, sagt aber auch: „Sie werden zu Recht fragen, was ist den von dem neuen Landrat zu erwarten. Zunächst einmal darf ich bemerken, dass die finanziell besten Zeiten für die Landkreise im Saarland vorüber sind.“ Verantwortlich hierfür seien die permanent steigenden Kosten für gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben, etwa für die Sozial- und Jugendhilfe. Darüber hinaus übertrage der Gesetzgeber den Landkreisen neue Aufgaben, ohne für einen angemessenen finanziellen Ausgleich zu sorgen. „Am stärksten ins Gewicht fällt hierbei“, betont Schumann, „die Übertragung der Gymnasien vom Land auf die Landkreise.“
Denn die Schulträgerschaft der beiden Gymnasien im Landkreis St. Wendel geht am 1. April 1993 auf den Landkreis über. Der Plan der Regierung ist bereits länger bekannt, die entsprechende Änderung des Schulordnungsgesetzes auch, sodass der Kreistag bereits am 19. Dezember 1991, noch unter dem Vorsitz von Schumanns Vorgänger, mehrheitlich beschließt, gegen diese Übertragung zu klagen. Nicht, weil man dies prinzipiell ablehne, betonen alle Verantwortlichen, sondern wegen der fehlenden finanziellen Entlastung durch das Land. Vergeblich: Am 10. Januar 1994 wird die Klage des Landkreises vom saarländischen Verfassungsgerichtshof abgewiesen, als der Kreis bereits fast ein Jahr die Gymnasien hat. Diese belasten den Kreishaushalt zunächst jährlich mit rund 1,15 Millionen DM zusätzlich.
Das teilt Landrat Schuman dem Kreistag am 9. März 1992 mit; es ist seine erste Sitzung als Vorsitzender des Gremiums und die Haushaltssitzung. Steigende Kosten seien auch bei der Jugendhilfe, beim Personal oder bei den Leistungen für die Kindertagesstätten zu verzeichnen, was zu einem Rekordhaushaltsvolumen von 65,5 Millionen DM und einer Kreisumlage von 29,5 Prozent – die Kommunalaufsicht korrigiert dies später auf 29,2 Prozent – führe. „Der Spielraum wird immer enger“, sagt Schumann. Der Spielraum für freiwillige Leistungen. Dennoch wolle man solide weiterwirtschaften und gestalten.
Kaum vier Wochen im Amt, präsentiert Landrat Schuman das erste Logo des Landkreises, ein neues Corporate Design. Initiiert wird dies bereits ein Jahr zuvor, die Verwaltung macht den Vorschlag und überzeugt den Kreisausschuss unter anderem mit der Feststellung: „Ein einheitliches Erscheinungsbild (CD) soll die Kommunikation mit den Bürgern, öffentlich organisierten Gruppen und Medien erleichtern. Es soll zum einen den Begriff ‚Heimat‘ in charakteristischer Weise vereinfacht durch ein Symbol (Logo) darstellen und zum anderen den Wandel der Behörde zum Dienstleistungsbetrieb verdeutlichen.“ Angeschrieben werden verschiedene Firmen, der Sieger liefert eine stilisierte Darstellung einer Sonne über Hügel und Berg sowie See. Diese drei Symbole, gibt das Siegerduo zu Protokoll, sollen den hohen Freizeitwert des St. Wendeler Landes widerspiegeln, der Berg sei der Schaumberg, der See natürlich der Bostalsee.
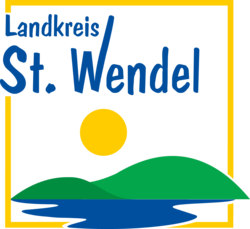
Und ein weiteres Projekt, das bereits vor seiner Amtszeit angestoßen wird, kann der neue Landrat in den ersten Wochen und Monaten zu einem erfolgreichen zumindest Zwischenabschluss bringen: Seit längerer Zeit bemüht sich unter anderem der Landkreis, am St. Wendeler Marienkrankenhaus ein geriatrisches Zentrum einzurichten. Doch die Frage der Finanzierung kann lange Zeit nicht zufriedenstellend geklärt werden, die Verhandlungen zwischen Träger, der Marienhaus GmbH, Land, Bund und Landkreis ziehen sich hin. Schließlich stockt das Land seinen Anteil von 500.000 auf eine Million auf, was den Weg für die Bundesförderung frei macht. Landrat Schumann, der St. Wendeler Bürgermeister Klaus Bouillon und der Landtagsabgeordnete Hans Ley reisen im Dezember nach Bonn, um mit Norbert Blüm, Bundesminister für Arbeit und Soziales, über die Pläne zu sprechen und den Bewilligungsbescheid zu erhalten. Das Zentrum soll 26,2 Millionen DM kosten, der Bund steuert 15 Millionen bei, der Träger 9,2 Millionen, Land und Landkreis jeweils eine Million. Schumann spart dennoch nicht an Kritik an der Landesregierung und bezeichnet ihren Anteil in der Saarbrücker Zeitung vom 30./31. Dezember 1992 als „beschämend gering“. Das bleibt nicht ungehört, der Anteil des Landes für die geriatrische Fachklinik, für die im Mai 1994 Richtfest gefeiert wird, steigt auf zwei Millionen Mark.
Kurz darauf später droht erneut Ungemach mit der Landesregierung. Grund ist der Kreishaushalt 1993. Diesen verabschiedet der Kreistag am 26. Februar 1993. Der Landkreis verzeichne erhebliche Mindereinnahmen, der Fehlbedarf von rund 10 Millionen DM gehe auf Vorgaben des Landes- und Bundesgesetzgebers zurück, betont Landrat Schumann während seiner Haushaltsrede. Der Kreis verfüge über kaum eigene Einnahmen, die Schlüsselzuweisung des Landes an den Landkreis sei um 14 Prozent gekürzt worden, alleine die Sozial- und Jugendhilfe steige 1993 um mehr als 4,5 Millionen DM. Es bleibe daher keine andere Wahl: Die Ausgaben müssen minimiert werden, die Kreisumlage muss steigen. Daher setzt die Verwaltung die Kreisumlage bei einem Gesamthaushaltsvolumen von rund 70 Millionen DM auf 36,6 Prozent. Natürlich stehe es den Gemeinden frei, gegen die Festsetzung der Kreisumlage zu klagen, was die Gemeinde Namborn auch im November des Jahres 1993 macht.
Noch bevor der Kreistag den Haushalt verabschiedet, meldet sich der Innen-Staatssekretär und verkündet, die Kreisumlage müsse gekürzt werden, der Landkreis St. Wendel führe eine unseriöse Haushaltspolitik. Das verärgert Landrat Schumann, er gehe doch davon aus, sagt er dem Kreistag, das Gremium habe über den Haushalt zu entscheiden, nicht der Staatssekretär.
Was das Gremium auch macht, und zwar mehrheitlich. Doch das Innenministerium als Kommunalaufsicht genehmigt, wie bereits angekündigt, diesen Haushalt nicht, denn die Kreisumlage sei zu hoch angesetzt, sie müsse um 0,75 Prozentpunkte gesenkt werden. Grund seien die nicht ausgeglichenen Haushalte der Gemeinde Oberthal und Namborn. Landrat Schumann ist allerdings der Meinung, der Haushalt sei rechtskonform, die Entscheidung der Kommunalaufsicht rechtswidrig, daher wolle man Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht.
Was der Kreistag am 19. Juli 1993 auch beschießt, einer Dringlichkeitssitzung, nachdem ein Gespräch mit dem Staatssekretär am 15. Juli keine Ergebnisse bringt. Das Gesprächsklima, berichtet der Landrat, sei befriedigend gewesen, die Standpunkte klar, eine Annährung nicht möglich. Die Kürzung, beschließt der Kreistag mit 11 zu 10 Stimmen, müsse hingenommen werden, geklagt wird trotzdem. Die Klage wird am 20. Juli 1993 eingereicht.
Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, währenddessen ist absehbar, dass auch der Haushalt für das Jahr 1994 ein weiterer Rekordhaushalt sein wird – mit entsprechender hoher Kreisumlage. Diesmal suchen Landrat und Staatssekretär im Vorfeld der Verabschiedung des Haushalts das Gespräch, auch öffentlich. „Wir müssen im Vorfeld darüber sprechen, bevor wieder das Verwaltungsgericht eingeschaltet wird“, sagt der Staatssekretär in der Saarbrücker Zeitung vom 12. November 1993. Er wird konkret: Zu überlegen sei, ob es sich der Landkreis St. Wendel erlauben könne, die Kreismusikschule, die sich in Trägerschaft des Kreises befindet, jährlich mit einer Million DM zu bezuschussen, auch über eine Privatisierung von zumindest Teilen des Freizeitzentrums Bostalsee müsse nachgedacht werden. „Es ist nicht Sache des Kreises, einen Campingplatz zu betreiben – auch wenn schwarze Zahlen geschrieben werden“, sagt der Staatssekretär.
Rote Zahlen schreiben so gut wie alle saarländischen Kommunen. Es sei die „größte finanzpolitische Herausforderung seit der Rückgliederung des Saarlandes“, heißt es dazu 1993 in einer Resolution die die Landräte des Saarlandes, die Oberbürger- und Bürgermeister sowie der Innenminister gemeinsam verabschieden. Land und Bund stehen mehr denn je in der Verantwortung, die Kommunen zu unterstützen – es gehe um deren Existenz. Effektives Sparen, ergänzt der Landrat während der Haushaltssitzung des Kreistags am 20. Dezember 1993, sei, wenn überhaupt, nur in einem eng begrenzten Rahmen möglich. Denn nach Abzug der gesetzlichen Aufgaben bleibe ein derart geringer Spielraum übrig, dass dadurch das „finanzielle Dilemma“ nicht gelöst werden könne. Daher müsse auch für das Jahr 1994 die Kreisumlage steigen: 38,37 Prozent schlägt die Verwaltung vor, das Gesamtvolumen: 77 Millionen Euro. Die Kommunalaufsicht senkt die Umlage auf 35,85 Prozent. Dagegen klagt der Landkreis diesmal nicht.
Die Klage des Kreises gegen die Beschneidung der Kreisumlage im Haushaltsentwurf 1993 wird in erster Instanz verloren. Doch es geht weiter, der Kreis geht in Berufung, erst 2001 urteilt das Oberverwaltungsgericht – und gibt dem Landkreis Recht. Gegenstand ist allerdings weniger die Kürzung der Umlage als die Frage nach dem, was ein Landkreis machen darf – und was nicht. Ein Urteil, das für alle saarländischen Landkreise von Bedeutung ist. Denn das Oberverwaltungsgericht urteilt, Landkreise dürfen durchaus neben gesetzlichen auch „überörtliche Aufgaben“ für die Gemeinden wahrnehmen, also etwa Wirtschafts- oder Tourismusförderung. Ein Urteil mit Strahlkraft. Daher sagt auch Peter Winter, Landrat des Landkreises Saarlouis und Vorsitzender des saarländischen Landkreistages, in der Saarbrücker Zeitung vom 24. September 2001: „Der Kreis St. Wendel hat sich mit seiner Klage bleibende Verdienste um die saarländischen Landkreise erworben. Dieses Urteil ist das erste, das sich grundsätzlich mit den Aufgaben des Kreises befasst.“ Dafür erstellte das Gericht aber auch einen Leitfaden, wie die Kreishaushalte aufgestellt und die Gemeinden angehört werden sollen. Schließlich bezahlen sie auch die überörtlichen Aufgaben des Kreises durch die Umlage.
Doch zurück in den Dezember 1993: Während der Kreistag über den Haushalt debattiert, steigen zeitgleich und in einem ungeheuren Tempo die Pegelstände der Flüsse im Saarland. Ein heftiger Dauerregen führt zum Jahrhunderthochwasser an Saar und Blies. Im Landkreis St. Wendel sind Feuerwehr und THW im Dauereinsatz, über 100 Mal müssen sie ausrücken. Auch in Saarbrücken müssen sie helfen, wo die Saar die Stadtautobahn, Keller und Häuser überflutet. Im Landkreis St. Wendel wird der Schaden auf etwa 392.000 Euro geschätzt. Eine Auswirkung des Hochwassers ist auch am Bostalsee zu spüren, denn Wasser dringt in die Kontrolldrainage. Zumindest nimmt man an, der Dauerregen trage Schuld. Der See muss abgelassen werden, dabei wird ein Riss im Damm entdeckt, kaum haaresbreit. „Es sieht so aus, als würden sich neue Risse bilden“, sagt Schumann. Sofort müssen Untersuchungen angestellt werden, währenddessen steigt die Angst in den Seedörfern, insbesondere in Gonnesweiler: Was, wenn der Damm bricht? Erinnerungen an das Jahr 1977 werden wach, als damals auch die Stabilität des Staudamms infrage gestellt wurde. Sorgen, die die Verwaltung, die der Landrat ernst nehmen. Und nichts beschönigen, die Bürger zu Informationsveranstaltungen einladen, Rede und Antwort stehen. Das soll auch ein Dammbauexperte, eigens aus Siegen nach Gonnesweiler bestellt. Soll, es jedoch nicht tut. 240 Menschen warten in Gonnesweiler vergeblich auf ihn, auch der Landrat, der dann selbst versucht, die Menschen zu beruhigen.
Auch ein weiteres Bostalsee-Thema beschäftigt Landrat Schumann fast während seiner gesamten Amtszeit. Ein Thema, das auch bereits seinen Vorgänger beschäftigte: das Feriendorf am Bostalsee, das bereits in den ersten Plänen des Bostalsees verzeichnet ist. Landrat Marner glückt es nicht, einen Investor zu finden, obschon es Interessenten gibt. Unter Landrat Schumann meldet sich ein neuer Interessent, der rund 200 Millionen DM investieren möchte, um ein Feriendorf mit 3500 Betten am Bostalsee zu errichten.
Er führt Gespräche mit dem Landkreis und der Gemeinde Nohfelden. Dabei spielt er mit offenen Karten: Er, der bereits im Norden Deutschlands ein Feriendorf errichtet hat, erwarte einen Landeszuschuss von mindestens 36 Millionen DM, ansonsten könne das Projekt nicht umgesetzt werden. Landkreis und Gemeinde tun alles, um die Pläne in die Tat umzusetzen, auch gegen Widerstände, etwa den Ortsrat von Gonnesweiler, der das Feriendorf einstimmig ablehnt. Gemeinde und Landkreis einigen sich etwa darauf, dass die Gemeinde Nohfelden den Ansiedlungsvertrag mit dem Investor aushandeln soll, der Kreis seine Fläche auf der Gonnesweiler Seite an den Investor verkauft. Landrat Schumann stellt aber auch klar, dass der Seerundweg, das Seeufer frei von jedweder Bebauung bleiben soll.
Die Pläne verdichten sich, doch das Land zieht nicht mit, trotz, wie der Investor öffentlich verkündet, positiver Signale aus dem Wirtschaftsministerium. Das Projekt scheitert jedoch nach jahrelangen Diskussionen. Während Schumanns Amtszeit werden Gespräche mit einem weiteren Investor geführt, die schließlich von Erfolg gekrönt sein werden, wenn auch die Eröffnung des Center Parcs Park Bostalsee nicht mehr in seine Amtszeit fällt. Doch noch während seiner Amtszeit, 2003, gründet sich die Bau- und Projektgesellschaft Ferienpark Bostalsee, die das jahrzehntelange Projekt zum Abschluss bringen soll, wobei sich erst 2006 das Unternehmen Center Parcs erst 2006 öffentlich äußert.
In den 1990er Jahren erfasst eine hohe Arbeitslosigkeit die Bundesrepublik, das Saarland. Wirtschaftlich schwierige Zeiten. Die Förderung der Wirtschaft nimmt daher auch für die Landkreisverwaltung und Landrat Schumann einen hohen Stellenwert ein. Dabei scheut man sich nicht, auch neue Wege zu beschreiten. So unterzeichnen Landrat Schumann und der St. Wendeler Bürgermeister Klaus Bouillon im Juli 1992 eine Kooperationsvereinbarung zur Gründung eines Unternehmer- und Technologiezentrums (UTZ), das insbesondere Existenzgründern den Weg in die Eigenständigkeit erleichtern soll. Landkreis und Kreisstadt gehen auch insofern neue Wege, als dass das einstige Gebäude der Marschall-Tabakfabrik umgebaut, modernisiert werden und jungen Unternehmern Fläche bieten, die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen soll. Die UTZ GmbH ist dafür zuständig, an ihr sind Kreis und Stadt je zur Hälfte beteiligt. 1993 beginnen die Bauarbeiten, im Januar 1995 ist der erste Bauabschnitt vollendet, im Juli 1996 der zweite. 12 Millionen DM kostet der Umbau, das saarländische Wirtschaftsministerium fördert diesen mit 70 Prozent.
Ein weiteres Projekt, das Landkreis und Kreisstadt gemeinsam angehen und umsetzen: die Konversion des einstigen französischen Militärgeländes in St. Wendel. Denn dass das französische Militär sich aus St. Wendel zurückzieht, ist seit 1997 bekannt, zunächst ungeklärt jedoch die Frage, wie die Kasernen (rund 29 ha) und der Truppenübungsplatz (210 ha) genutzt werden sollen. Somit gründen am 3. März 1999 der Landkreis St. Wendel und die Kreisstadt St. Wendel die Wendalinuspark St. Wendel GmbH, die eben die Konversion, also Umwandlung des Geländes und der Gebäude, vorantreiben soll. Die Gesellschaft kauft bereits vor dem Abzug der Soldaten die Fläche vom Bundesvermögensamt für 6,75 Millionen DM, auch wenn der Bund den Gesamtwert auf 9,8 Millionen DM schätzt, in der Öffentlichkeit wesentlich höhere Zahlen rumgeistern. Die ersten notwendigen infrastrukturellen Investitionen schätzt man auf 30 Millionen Euro, das Land sagt eine Förderung von 70 Prozent zu, sodass die Arbeiten bereits im November 1999 beginnen können, offizieller Spatenstich ist im Januar 2000.

1994 stehen Kommunalwahlen an. Dabei erhält die CDU mit 48,5 Prozent bei der Kreistagswahl 15 Sitze im Gremium, gewinnt somit einen im Vergleich zur Wahl von 1989, die SPD verliert mit 42 Prozent einen Sitz und kommt nun auf 12. Die Grünen scheitern mit 4,6 Prozent an der 5-Prozent-Hürde, genauso wie die FDP mit 1,3 Prozent; auf sonstige Parteien oder Gruppierungen entfallen 3,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung beträgt 82,6 Prozent, Wahlberechtigt sind 75.633 Bürger des Landkreises St. Wendel.
Der neue Kreistag und die neu besetzten Kreistagsausschüsse müssen die Arbeit nahtlos fortsetzen. Dazu gehört auch das Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Denn dieser ist in den 1990er Jahren im Wandel begriffen. Daher hat der Kreisausschuss bereits 1991 eine Arbeitsgruppe „Öffentlicher Personennahverkehr“ eingerichtet. Dieser wird nach der Wahl zu einem Kreistagsausschuss, vor der Wahl kommt auch eine ÖPNV-Arbeitsgruppe innerhalb der Verwaltung zusammen. Auf Bundes- und Europaebene kommt es zu einschneidenden Bestimmungen, die den bisherigen ÖPNV und seine Strukturen massiv verändern. Schließlich verabschiedet der saarländische Landtag im November 1995 das ÖPNV-Gesetz: Das Land (oder ein Zweckverband) übernehmen den schienengebundenen Personennahverkehr, die Landkreise (und der Stadtverband Saarbrücken) sind ab dem 1. Januar 1996 für den ÖPNV auf der Straße zuständig. Und müssen zunächst Nahverkehrspläne aufstellen: den Ist-Zustand darstellen, das zukünftige geschätzte Verkehrsaufkommen, Pläne und Finanzierung, Ziele und Verknüpfungen mit anderen Verkehrsarten. Die Verwaltung gründet den Eigenbetrieb „Kreisverkehrsbetrieb ÖPNV St. Wendel“, um die Aufgaben meistern zu können. Wenn schon, ist die Meinung der Verwaltung, der Kreis für alles zuständig ist, dann soll er auch eigenständig über die Vergabe der Buslinien entscheiden. Dazu gehören auch die Konzessionen der Buslinien. Oder wie Landrat Schumann es in der Saarbrücker Zeitung vom 3. Juni 1998 ausdrückt: „Wir wollen alle Linien neu ausschreiben und an den billigsten Anbieter vergeben. Die Linien mit Gewinn und die, bei denen ein Minus zu erwarten ist.“ Dies untersagt aber das Wirtschaftsministerium. Die Linien-Konzessionen gehören einer bereits 1989 gegründeten GmbH, einer Tochter der Deutschen Bahn, eine Übertragung nicht so einfach machbar. Dagegen klagt der Kreis. Und doch muss es vorangehen, so richtet er, um den eigenständig erstellten und 1997 präsentierten Nahverkehrsplan umzusetzen, etwa gemeinsam mit der Bahn-Tochter als Modellprojekt eine Gemeindelinie von Oberthal bis nach Wadern ein, dazu eine Ferienlinie zwischen Tholey und Nohfelden.
Der ÖPNV-Eigenbetrieb des Landkreises muss sich nur kurz darauf weiterer Aufgaben annehmen. Denn die Deutsche Bahn plant, die Ostertalbahn, auf der die Personenbeförderung bereits 1980 endete, allerdings noch Güterzüge verkehren, nun endgültig stillzulegen. Der Grund: zu geringe Trasseneinnahmen. Landrat Schumann schaltet sich ein. Er ist für den Erhalt der Strecke, auf der ein Rüstungsbetrieb in der Gemeinde Freisen noch Güter transportiert, offen für eine alternative Nutzung. Verschiedene Gespräche werden geführt, bis schließlich Schumann 1999 verkünden kann, der Kreis werde zwei Anträge stellen: einen an das Eisenbahnbundesamt, um die Trasse zu erwerben, und einen an das Verkehrsministerium, damit der kreis als Eisenbahninfrastrukturunternehmen anerkannt wird. Was auch klappt: aus dem Kreisverkehrsbetrieb wir der Kreisverkehrs- und Infrastrukturbetrieb, der die Ostertalbahnstrecke übernimmt. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen werden nun die alten Bahnhöfe saniert, ab April 2001 verkehrt eine touristische Sonderbahn auf der Strecke, nach über 20 Jahren ist somit wieder Personenbeförderung möglich. Diese findet bis heute statt, denn der Kreis pachtet die Strecke für 25 Jahre, der Güterverkehr wird allerdings einige Jahre nach der Einrichtung der touristischen Bahn auf die Straße verlegt.
Zuständig ist der Landkreis St. Wendel auch seit dem 1. Januar 1997 für alle weiterführenden Schulen – mit Ausnahme der Privatschule – im Kreisgebiet. Denn die Schulträgerschaft geht qua Gesetz von den Gemeinden auf den Landkreis über. Ein Übergang, der im Landkreis St. Wendel einvernehmlich und geradezu lautlos vonstattengeht, im Ministerium gar als vorbildlich gepriesen wird. Denn der Landkreis schließt mit jeder Gemeinde eine Vereinbarung. Alle laufenden Verträge und Vereinbarungen übernimmt der Kreis, er zahlt für die Nutzung von etwa gemeindeeigenen Sporthallen einen Ausgleich. Einen Ausgleich gibt es auch für Gemeinden, die jüngst in die weiterführenden Schulen investiert haben. Landrat Schumann ist zufrieden, wie er der Saarbrücker Zeitung vom 2. Januar 1997 sagt: „Bei dem Schulkompromiss gibt es Gemeinden, die viel davon profitieren und andere, die eher dazuzahlen. Dennoch hat die Vernunft obsiegt, alle Gemeinden haben gesagt, da machen wir mit, weil es eine gute und richtige Lösung ist!“ Für den Landkreis entstehen durch die Übernahme Mehrkosten von rund 4,5 Millionen DM, die jedoch, wie Schumann dem Kreistag im Januar 1997 mitteilt, nur „innerhalb der kommunalen Familie von den Gemeinden auf die Landkreise“ verschoben werden. Doch gefällt nicht alles der Kommunalaufsicht, die daher bei der Genehmigung des Haushalts für das Jahr 1997 einige Nachfragen hat und die Kreisumlage heruntersetzt; diese beträgt erstmals in der Geschichte des Landkreises über 50 Prozent.
Schließlich steht eine weitere große Veränderung während Schumanns Amtszeit an: die Kommunalisierung der Landratsverwaltung. Bis zum 31. Dezember 1996 besteht die Verwaltung des Landratsamtes aus einer staatlichen und einer kommunalen Verwaltung. Der Landrat ist somit für zwei voneinander unabhängige Verwaltungszweige verantwortlich, wenn auch nur für eine, die kommunale, zuständig, auch wenn das der Bürger normalerweise nicht merkt. Diese Trennung wird nun aufgehoben, von der staatlichen gehen auf die kommunale Verwaltung über: die Straßenverkehrs-, Bauaufsichts-, Kreispolizeibehörde, der Kreis ist nun zuständig für Ausländer- und sonstige Staatshoheitsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, den schulpsychologischen Dienst, das Veterinärs- und Gesundheitsamt, Kreisrechtsausschuss und die Kommunalaufsicht für die Gemeinden. 114 neue Beschäftigte zählt dadurch der Landkreis, insgesamt sind es 354.
1999 stehen erneut Kreistagswahlen an. 76.571 Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Zusammensetzung dieses Gremiums zu entscheiden. 73,7 Prozent machen von ihrem Wahlrecht Gebrauch: Für die CDU stimmen 55,7 Prozent, für die SPD 40,1 Prozent, 2,7 Prozent für Die Grünen und 1,4 Prozent für die FDP. Dies führt dazu, dass die CDU nun über 16 der 27 Sitze verfügt, die SPD über 11.
Anfang der 1990er Jahre werden im Saarland Stimmen immer lauter, Bürgermeister und Landräte direkt zu wählen, nicht mehr durch Stadt- und Gemeinderäte bzw. Kreistage. Ein Volksbegehren im April 1994 unterschreiben innerhalb kürzester Zeit über 15.000 Saarländer. Die SPD-Landesregierung reagiert schnell. Bereits am 11. Mai 1994 verabschiedet der saarländische Landtag das „Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Kommunalselbstverwaltungsrechts und des Kommunalwahlrechts“. Darin heißt es unter anderem: „Der Landrat wird von den Bürgern im Landkreis in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für die Dauer von acht Jahren gewählt.“ Landrat Franz Josef Schumann ist seit dem 1. März 1992 im Amt, zunächst vom Kreistag für 10 Jahre gewählt. Nun möchte er wiedergewählt werden, diesmal direkt von den Bürgern des Kreises.
Die Landratswahl soll am 10. Juni 2001 stattfinden. Das beschließt der Kreistag am 12. Februar 2001 mehrheitlich. Einstimmig einigt sich das Gremium auf einen Ausschreibungstext, der klarstellt, wer wählbar ist und wie gewählt wird. Die Bewerbungsfrist wird auf den 5. April festgesetzt. Bis dahin erreichen die Kreisverwaltung zwei Bewerbungen: die des Stelleninhabers und die des SPD-Kandidaten Armin Lang, Mitglied des Kreistags. Das Ergebnis der ersten Direktwahl des Landrates des Landkreises St. Wendel: 70,6 Prozent der Wahlberechtigten stimmen für Franz Josef Schumann, saarlandweit das beste Ergebnis aller Landratswahlen, denn in den anderen Landkreisen und dem Stadtverband erringen die jeweiligen Sieger höchstens 55 Prozent.
Als nun von den Bürgern gewählter Landrat, geht Schumann in den kommenden Jahren eine weitere große Reform an, diesmal nicht von außen verordnet, sondern freiwillig: Der Landkreis St. Wendel soll eine Optionskommune werden. Dies machte die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 2005 im Zuge der so genannten Hartz-Reformen möglich. Die Sozialhilfe regelt bis dahin das Bundessozialhilfegesetz (BSHG), das der Bundestag 1962 verabschiedet. Zuständig für die Umsetzung sind die Kommunen. Mit steigender Arbeitslosigkeit, insbesondere seit den 1980er Jahren, belastet die Sozialhilfe die kommunalen Haushalte immer stärker; auch, weil die Bundesanstalt für Arbeit seit den 1980er Jahren die Mittel für die Arbeitsförderung kürzt, somit mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sind. Daher müssen die Kommunen auch arbeitsmarktpolitisch tätig werden, was das BSHG etwa im Rahmen der „Hilfe zur Arbeit“ nach §19 ermöglicht. Dies macht der Landkreis seit dem Ende der 1980er Jahren, in Kooperation mit Gemeinden oder freien Träger, um Sozialhilfeempfänger wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. 1994 startet der Landkreis St. Wendel ein eigenes Programm, die „Beschäftigungsinitiative Landkreis St. Wendel“ (BILS). Ein Anreizprogramm: Betriebe erhalten Lohnkostenzuschüsse, wenn sie arbeitslose Sozialhilfeempfänger befristet oder auf Dauer einstellen. 1996 investiert der Landkreis St. Wendel für alle „Hilfen zur Arbeit“-Maßnahmen rund 3 Millionen DM, dank der BILS-initiative können 22 Sozialhilfeempfänger vermittelt werden. 1999 werden die BSHG-Maßnahmen im Landkreis St. Wendel neu strukturiert, zentralisiert, die Kommunale Arbeitsförderung als Modellprojekt in der Verwaltung eingeführt: Hier arbeiten das Arbeitsamt als Träger der Arbeitslosenhilfe und der Landkreis als Träger der Sozialhilfe zusammen – ein Modellprojekt mit bundesweitem Vorbildcharakter, das der Kreistag am 8. November 1999 einstimmig beschließt.
Nun nimmt auf Bundesebene die Diskussion um eine grundlegende Sozialreform Fahrt auf, dies mündet unter anderem in der Neuregelung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Zusammenlegung von Arbeits- und Sozialhilfe (Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich: „Hartz IV“). Nun muss nur noch die Frage geklärt werden, wer dafür zuständig sein soll. Der Gesetzgeber ermöglicht verschiedene Möglichkeiten, favorisiert die Bildung von Arbeitsgemeinschaften (ARGE) von Bund und Kommune, wo dies nicht möglich sei, die weiterhin getrennte Aufgabenwahrnehmung – oder die „kommunale Option“, somit die alleinige Zuständigkeit der Kommune. 69 Modellkommunen soll dies ermöglicht werden. Der Landkreis St. Wendel möchte diese Option ziehen.
Nun ist Überzeugungsarbeit gefragt, denn die Landesregierung steht den Plänen des Landkreises eher reserviert gegenüber. Für Landrat Schumann sprechen mehr Argumente für als gegen die kommunale Option, wie er dem Kreistag am 13. September 2004 zusammenfassend erläutert: Bratung, Arbeitsvermittlung, Geldleistungen bleiben in einer Hand, die Kreisumlage wird nicht belastet, der Kreis trifft alle Entscheidungen selbst. Der „Verschiebebahnhof“, also die Zuweisung von Arbeitssuchenden von Arbeits- zu Sozialamt und wieder zurück, nehme ein Ende, die Kommunale Arbeitsförderung, das erfolgreiche Modellprojekt, könne weiterbestehen, die Mitarbeiter der Gemeinde-Sozialämter können in das neue Job-Center des Landkreises wechseln. Mehrheitlich ist der Kreistag überzeugt und stimmt der kommunalen Option zu: Zum 1. Januar 2005 wird der Landkreis St. Wendel eine Optionskommune. Ein Jahr danach zieht Landrat Schumann in der Saarbrücker Zeitung vom 1. März 2006 eine erste Bilanz, die durchwegs positiv ist: Der Kreis kenne seine Kunden „und die wirtschaftliche Infrastruktur des Kreises bestens und dazu können wir bereits mehrere Jahre erfolgreiche Arbeit im Bereich der Arbeitsvermittlung vorweisen“. Innerhalb eines Jahres konnten 569 Leistungsempfänger in Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden. 2006 beträgt die Arbeitslosenquote im Landkreis St. Wendel 6,9 Prozent. Der niedrigste Wert im Saarland.
Ein Argument für die kommunale Option ist auch die langjährige Erfahrung im Bereich der Förderung der Wirtschaft. Bereits 1980 richtet der Landkreis ein Amt für Wirtschaftsförderung, später: Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik, ein. Wie seine Vorgänger, ist auch Landrat Schumann stetig bemüht, Unternehmen in der Region anzusiedeln, die heimische Wirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Etwa mit der „Initiative 2000“, die Schumann 1994 vorstellt, und die die Förderung von Existenzgründungen, die Vermarktung der Region und die Förderung von beruflicher Qualifizierung zum Schwerpunkt hat. 1996 gibt der Kreis ein Strukturgutachten in Auftrag, um die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises auszuloten, mit dem UTZ und der Konversion des französischen Militärgeländes werden weitere Schwerpunkte gesetzt, 2004 wird die Wirtschaftsförderung neu strukturiert. Denn aus dem Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik wird eine GmbH.
Dieses Modell bevorzuge die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes, wie Landrat Schumann dem Kreistag am 16. Februar 2004 mitteilt. Zudem sei es Wunsch des Kreistages, die Wirtschaftsförderung neu zu ordnen. Weitere Vorteile: Viele Akteure können in eine GmbH eingebunden werden, darunter auch private, der Handlungsspielraum ist größer. Somit gründet sich zum 1. Juli 2004 die Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH, deren Gesellschafter der Landkreis und seine Gemeinden bzw. die Kreisstadt, die Kreissparkasse St. Wendel und die Saar LB sind.
Ebenfalls in die Amtszeit von Landrat Schumann fällt die bisher letzte Grenzkorrektur des Landkreises, die ein Staatsvertrag regelt, der 2003 unterschrieben wird. Dabei geht es um das saarländische Haupersweiler und das rheinland-pfälzische Herschweiler, genauer um die Straße „In der Gass“, in der 55 Menschen leben. Sie wird umgemeindet, 55 Saarländer werden zu Pfälzern. Als Entschädigung erhält die Gemeinde Freisen 40.000 km² Land und 106.000 Euro.
Ein Jahr später stehen erneut Kreistagswahlen an. Bei einer Wahlbeteiligung von 67,3 Prozent fallen auf die CDU 61 Prozent der abgegebenen Stimmen, die SPD erhält 32,2 Prozent, für die Grünen stimmen 3,9 Prozent, die FDP 2,9 Prozent. Im neugewählten Kreistag, der zum ersten Mal am 5. Juli 2004 zusammentritt, hat die CDU nun 18 Sitze, die SPD 9.
Bereits kurz darauf beschäftigen sich das Gremium und Landrat Schumann mit dem Hesse-Gutachten. Dieses Gutachten gibt das saarländische Ministerium für Inneres und Sport im Oktober 2003 in Auftrag. Prof. Dr. Joachim Hesse, Vorstandsvorsitzender des internationalen Instituts für Staats- und Europawissenschaften in Berlin, soll, fast 30 Jahre nach der saarländischen Gebiets- und Verwaltungsreform, de kommunalen Verwaltungsstrukturen im Saarland untersuchen. Im Oktober 2004 legt er auf 600 Seiten die Ergebnisse seiner Untersuchungen vor. Darin diskutiert er auch die Zusammenlegung von Landkreisen, dies wird dann in der Öffentlichkeit überwiegend diskutiert. Dabei, erläutert Landrat Schumann am 22. November 2004 vor dem Kreistag, beinhalte das Gutachten zahlreiche Vorschläge, in 40 Sachgebiete aufgeteilt, viele davon stärken die Kreise. Daher könne er die Idee, Landkreise zusammenzulegen, nicht ganz nachvollziehen, und betont, die Landkreise und der Stadtverband haben sich als leistungsfähige, überschaubare und dadurch bürgernahe, demokratisch legitimierte Verwaltungseinheiten bewährt. Deutlicher wird er in der Saarbrücker Zeitung: „Es gibt keine Alternative zu den Landkreisen. Die meisten Aufgaben sind vom Gesetzgeber vorgegeben und deren Erfüllung ist für viele Menschen unentbehrlich.“
Das Gutachten führt zu keiner Zusammenlegung der Kreise, doch bewirkt es zahlreiche Änderungen der Verwaltungsstrukturen, ähnlich wie bei der Kommunalisierung 1997, diesmal allerdings primär in die Gegenrichtung. Denn einige kommunale Aufgaben, etwa die Veterinärbehörde, die untere Kommunalaufsicht, die untere Naturschutzbehörde, wurden auf die Landesebene gehievt. So sieht es das saarländische Verwaltungsstrukturreformgesetz, das am 1. Januar 2008 in Kraft tritt.
Den aktuellen Stand der der Umsetzung des Hesse-Gutachtens schildert Landrat Schumann dem Kreistag am 27. März 2007 im öffentlichen Teil der Sitzung. Der nicht-öffentliche Teil besteht aus zwei Tagesordnungspunkten. Der zweite lautet: Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Antragsteller ist Landrat Franz Josef Schumann, der zum 31. Dezember sein Amt niederlegen möchte. Dem stimmt der Kreistag einstimmig zu. Über mögliche berufliche Pläne des amtierenden Landrats wird bereits seit längerer Zeit in der Öffentlichkeit spekuliert. Nun die Gewissheit: Franz Josef Schumann wird nach 16-jähriger Amtszeit als Landrat des Landkreises St. Wendel zum 1. Januar 2008 Präsident des saarländischen Sparkassenverbandes. Sein Nachfolger im Landratsamt wird Udo Recktenwald, der sich bei der Landratswahl am 1. Juli 2007 mit 52,4 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen zwei Gegenkandidaten durchsetzt.
